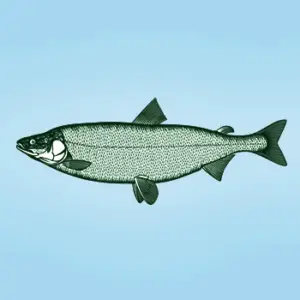Das Maul der Neunaugen sieht furchteinflößend aus. Tatsächlich ernähren sich diese Fische durch das Blut anderer Tiere, das sie ihnen aussaugen.

Neunaugen. Bild: Petromyzon marinus, CC BY-SA 4.0
Steckbrief Neunauge
- Name: Neunauge. Engl.: Lamprey eels
- Wiss. Name: Petromyzontiformes
- Klasse: Rundmäuler (Cyclostomata)
- Ordnung: Neunaugenartige (Petromyzontiformes)
- Familie: Neunaugen (Petromyzontidae)
- Verbreitung: kalte und gemäßigte Zonen rund um die Welt
- Lebensraum: küstennahe Meeresgewässer und Flüsse
- Nahrung: Blut anderer Tiere
- Verhalten: Einzelgänger
- Maximale Größe: 120 cm
- Maximales Alter: 10 Jahre
- Körperform: schlangenförmig
- Körperfarbe: hellgrau bis grünlich, mit Flecken oder marmoriert
- Maul: ringförmiges Saugmaul mit hornigen Zähnen
- Schuppen: schuppenlos
- Flossen: sehr klein und kaum zu sehen
- Geschlechtsreife: mit 5-8 Jahren
- Laichzeit: Frühjahr
- Wirtschaftliche Bedeutung: als Speisefische unbedeutend, da sie mit Umweltgiften stark belastet sind
- Kulinarische Qualität: aalähnliches feines Fleisch mit hohem Fettgehalt / geeignet zum Braten, Backen, Grillen und Räuchern
- Nährwert (100 g): 113 kcal / 19 g Eiweiß / 4,1 g Fett
- Angelsport: unbedeutend
- Gefährdung: aufgrund Verhinderung der Laichwanderwege durch Querbauwerke z.T. stark gefährdet
Herkunft und Lebensraum
Neunaugen sind biologisch gesehen keine Fische sondern eine Ordnung fischähnlicher, stammesgeschichtlich basaler Wirbeltiere (Vertebrata), lebende Fossilien, die sich seit 500 Millionen Jahren kaum verändert haben. Sie haben einen aalartigen, langgestreckten Körper, der mit einem flossenartigen Rücken- und Schwanzsaum besetzt ist. Die Tiere haben zwei Augen (die vermeintlichen sieben weitere Augen sind Kiemenspalten).
Neunaugen kommen überwiegend in Küstengewässern und Süßwasser in kalten und gemäßigten Zonen vor. Ihr Verbreitungsgebiet umfasst Europa, das kalte und gemäßigte Asien, Nordamerika, Patagonien, den Südosten Australiens (inklusive Tasmanien) und Neuseeland. Für mindestens eine Art, nämlich Geotria australis, wird angenommen, dass sie auch beachtliche Distanzen im offenen Meerwasser zurücklegt.
Neunaugen-Plage in Nordamerika
Sehr stark haben sich Meerneunaugen als Neozoon in den nordamerikanischen Großen Seen ausgebreitet, wo sie durch Schiffe und Kanäle eingeschleppt wurden und keine natürlichen Feinde haben. Dort sind sie zur Plage geworden und bedrohen die einheimischen Fischbestände.[1] In Nordamerika gibt es für sie traditionell und aus anderen Gründen („Blutsauger“) keinen Markt als Speisefisch.
Außerdem sind die Tiere aufgrund ihrer Lebensweise zu stark mit Umweltgiften belastet. Sie werden mit Fallen (unter anderen auch mit künstlichen Pheromonfallen) und speziellen Giften in den Oberläufen der zufließenden Gewässer bekämpft. Da Neunaugen biologisch gesehen keine Fische sind und sich in ihrer Körperchemie stark von Fischen unterscheiden, war es möglich, Giftstoffe zu finden, die für Neunaugen, aber nicht für echte Fische giftig sind.
Wichtige Merkmale
Äußerlich ähneln Neunaugen mehr den Aalen oder Schlangen als gewöhnlichen Fischen. Je nach Art werden Neunaugen circa 20 bis 40 cm groß, im Meer bis zu 75 cm, vereinzelt auch größer. Die Haut der Neunaugen hat keine Schuppen. Die Tiere zeichnen sich durch ein großes ringförmiges Maul mit vielen hornigen Zähnen, besitzen aber keine keine Kiefer. Das rundliche Maul ist als Saugmaul ausgebildet.
Die erwachsenen Tiere haben zwei Augen. Die Flossen des Neunauges sind reduziert und erfüllen kaum noch ihre Funktion – in der Regel sind sie sogar am Körper des Neunauges kaum zu sehen. Die Tiere schwimmen dank ihrer schlängelnden Bewegungen wie Schlangen oder Muränen.
Wie viele Augen hat ein Neunauge wirklich?
Neunaugen haben nur zwei Augen. Ihr Name geht auf die als Augen anmutenden sieben seitlichen Kiemenspalten und die (unpaare) Nasenöffnung (also neun „Augen“ auf jeder der beiden Körperseiten) zurück.
Wanderung der Neunaugen
Bei etwa der Hälfte der Arten, die zu den Neunaugen gerechnet werden, wandern die ausgewachsenen Tiere ins Meer, wo sie bis zu 18 Monate als Parasiten leben[2], gewöhnlich nahe der Küste. Zu den Arten, bei denen dies vorkommt, zählen unter anderem die auch in Mitteleuropa verbreiteten Meer- und Flussneunaugen. Ihre Wirte sind Fische, an denen sie sich festsaugen, Blut trinken und Fleischstücke herausraspeln.[3]
Blutsaugende Ernährung
Durch spezielle Substanzen in ihrem Speichel hemmen die Neunaugen die Blutgerinnung, weshalb bei angegriffenen Fischen keine Blutgerinnsel entstehen. Forscher versuchen, diese Substanz aus dem Speichel zu extrahieren, um sie in der Medizin einzusetzen und Blutgerinnsel aufzulösen. Größere, gesunde Fische überleben solche Angriffe meist und behalten nur typische kreisförmige Narben zurück, kleinere Arten jedoch, Jungtiere und kranke Fische können daran sterben.
Sind Neunaugen für Menschen gefährlich?
Größere Neunaugen greifen vereinzelt in Küstennähe auch Menschen an und saugen deren Blut. Die Bisse sind für den Menschen nicht giftig, können aber geringe Schmerzen verursachen.[4]
Nichtparasitische Neunaugen
Etwa zwanzig Arten der Neunaugen sind stationäre, nichtparasitische Süßwasserbewohner.[5] Ein Beispiel für eine solche Art ist das Bachneunauge. Die Larven stationärer Neunaugen graben sich im Gewässergrund ein und ernähren sich von Kleinorganismen, die sie aus dem Wasser filtrieren. Nach der Larvenzeit nehmen sie keine Nahrung mehr zu sich. Bereits während der Umwandlung in adulte Tiere bildet sich der Darm zurück. Die Tiere laichen nur noch ab und sterben dann.
Weitere nur im Süßwasser vorkommende stationäre Neunaugen sind das Oberitalienische Neunauge, das nur in Seitenflüssen des Pos vorkommt, und das nur im Einzugsgebiet der Donau vorkommende Ukrainische Bachneunauge (Eudontomyzon mariae). Das donauendemische Donauneunauge (Eudontomyzon danfordi) weicht von diesem Verhaltensmuster ab. Es ist die einzige europäische Neunaugenart, die an Süßwasserfischen wie Barschen und Döbeln parasitiert.
Fortpflanzung der Neunaugen

Neunaugen. Bild: Jõesilmud2, CC BY-SA 3.0
Neunaugen laichen im Oberlauf von Bächen und Flüssen. Sie benötigen hierfür kiesige Substrate, die von kühlem, sauerstoffreichem Wasser durchströmt werden (daher kommen sie in den Tropen nicht vor).
Die noch augenlosen, wurmartigen Larven der Neunaugen werden Querder genannt. Sie vergraben sich nach dem Schlüpfen in sandigen Abschnitten der Gewässersohle. Der Kopf bleibt frei und fischt feine Nahrungspartikel (Plankton) aus dem Wasser. Meist nach 5 bis 7 Jahren erfolgt eine recht radikale Umwandlung (Metamorphose) des Körperbaus zum erwachsenen Tier.
Kulinarische Bedeutung
Der größte und auch wirtschaftlich genutzte Vertreter der Neunaugen ist das Meerneunauge. Sein Fleisch ist weiß und fein, mit Aal vergleichbar, im Geschmack „fleischiger“ als das Fleisch der meisten echten Fische. Noch im 19. Jahrhundert wurden in Norddeutschland Hunderttausende von Meerneunaugen gefangen, gebraten und mit Essig und Kräutern mariniert angeboten. Auch kleinere Flussneunauge wurde bis in neuere Zeit in Elbe und Weser gefangen und über Holzkohle gegrillt.
In Frankreich, Galicien und Portugal stehen Lampreten (so werden Neunaugen in der Küche bezeichnet) noch heute auf traditionellen Speisekarten. Ein klassisches Lampretengericht ist Lamproie à la Bordelaise, bei dem die Stücke in einer Sauce aus Bordeaux-Wein, dem Blut der Neunaugen, rohem Schinken, Porree, Zwiebeln und Knoblauch gedünstet werden. Im Baltikum werden die Neunaugen auf den Märkten angeboten und gegrillt oder geräuchert verzehrt.
Mittlerweile gehören Neunaugen in Europa zu den gefährdeten Arten und werden immer seltener kulinarisch verarbeitet. Die zahlreichen Schutzbestimmungen lassen immer weniger Möglichkeiten zum Verzehr der seltenen Tiere.
Einzelnachweise
- ↑ Parasiten in der Falle. In: der Standard. Abgerufen am 2. August 2023.
- ↑ S. Silva, M. J. Servia, R. Vieira-Lanero, S. Barca, F. Cobo: Life cycle of the sea lamprey Petromyzon marinus: duration of and growth in the marine life stage. In: Aquatic Biology. 18, 2013, S. 59–62. doi:10.3354/ab00488.
- ↑ S. Silva, M. J. Servia, R. Vieira-Lanero, F. Cobo: Downstream migration and hematophagous feeding of newly metamorphosed sea lampreys (Petromyzon marinus Linnaeus, 1758). In: Hydrobiologia. 700, 2013, S. 277–286. doi:10.1007/s10750-012-1237-3.
- ↑ Blutige Neunaugen-Attacken in der Ostsee. (Memento vom 21. Dezember 2009 im Internet Archive) 24. August 2019.
- ↑ Roland Gerstmeier, Thomas Romig: Die Süßwasserfische Europas. Franckh-Kosmos, Stuttgart 2003, ISBN 3-440-09483-9, S. 129.
- ↑ Volker Storch, Ulrich Welsch: Systematische Zoologie. Fischer, 1997, ISBN 3-437-25160-0, S. 544–548.
Quellenhinweise
Dieser Artikel wurde der Wikipedia entnommen und steht unter dieser Nutzungslizenz.