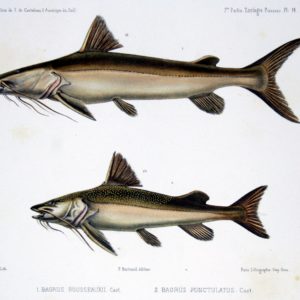Der Stromschlag eines Zitteraals kann bis zu 600 Volt stark sein und ist für einen Menschen überaus gefährlich.

Zitteraal. Bild: Electric eel
Steckbrief Zitteraal
- Name: Zitteraal. Engl.: Electric eel
- Wiss. Name: Electrophorus electricus
- Ordnung: Neuwelt-Messerfische (Gymnotiformes)
- Familie: Messeraale (Gymnotidae)
- Gattung: Electrophorus varii
- Verbreitung: Flusssystem des Amazonas
- Lebensraum: Nebenflüsse und Bäche mit schlammigem Boden
- Nahrung: Fische, Amphibien, Vögel und kleine Säugetiere
- Verhalten: Raubfisch, überwiegend Einzelgänger
- Maximale Größe: 150 cm
- Maximales Gewicht: 14 kg
- Alter: noch keine sicheren Erkenntnisse
- Körperform: langgestreckt und schlangenartig, rund im Querschnitt
- Körperfarbe: dunkelgrau, junge Fische sind oliv-braun mit gelben Flecken
- Maul: groß und endständig
- Schuppen: nur entlang der Seitenlinien, sonst schuppenlos
- Schuppenformel: SL 124-186
- Geschlechtsreife: noch keine sicheren Erkenntnisse
- Laichzeit: September bis Dezember
- Wirtschaftliche Bedeutung: werden nur von einheimischer Bevölkerung als Speisefische verwendet
- Angelsport: unbedeutend
- Gefährdung: aufgrund Abholzung des Regenwaldes und Umweltverschmutzung z.T. stark gefährdet
Herkunft und Lebensweise
Der Zitteraal lebt in Südamerika in den Flusssystemen des Amazonas und Orinoco. Sein Habitat erstreckt sich auf warmes, trübes und nicht selten sehr sauerstoffarmes Wasser. Er fühlt sich in Nebenflüssen, Bächen und sogar in Sümpfen wohl.
Für Biologen ist der Zitteraal ein Phänomen. Er vereint eine Vielzahl von Merkmalen, die oft zu verschiedenen Fischen gehören. So verbringt er z.B. die meiste Zeit am Boden, steigt aber alle 10 Minuten auf, um Sauerstoff zu atmen. Weiterhin ist er ein nachtaktiver Raubfisch, der sehr schlecht sehen kann und auf sein elektrisches Feld angewiesen ist, das er zur Orientierung und zur Suche nach Beute einsetzt.
Wie stark ist der Stromschlag eines Zitteraal?
Im Ruhezustand beträgt die Stromfrequenz des Zitteraals 50 kHz. Bei der Jagd oder Selbstverteidigung kann er allerdings einen Stromschlag von bis zu 600 Volt erzeugen. Das reicht aus, um die meisten Fische und sogar ein Tier von der Größe eines Pferdes zu lähmen. Dementsprechend ist Zitteraal auch für den Menschen sehr gefährlich.
Wichtige Merkmale
Der Körper des Zitteraals ist langgestreckt und zylindrisch. Die Körperfarbe ist meist dunkelgrau. Jungtiere sind olivbraun mit gelben Flecken. Der Zitteraal hat keine Rückenflosse, dafür aber eine sehr lange Afterflosse, die er zum Schwimmen nutzt. Sein Kopf ist abgeflacht und hat ein großes, viereckiges Maul. In der Natur kann der Zitteraal bis zu 250 cm lang und über 20 kg schwer werden.
Obwohl er Kiemen hat, muss der Zitteraal regelmäßig an die Oberfläche aufsteigen, um Luft zu atmen. Die Sauerstoffaufnahme passiert über die Mundschleimhaut, die mit vielen Blutgefäßen versehenen ist. Diese physiologische Eigenschaften ermöglichen es dem Zitteraal, übers Land zu kriechen und sich in neuen Gewässern niederzulassen.
Elektrische Organe des Zitteraals
Die Elektrizität im Körper des Aals wird durch sein Muskelgewebe erzeugt. Etwa vier Fünftel der Gesamtlänge der Fische ist mit elektrischen Organen (Elektroplax) besetzt, die zusammen wie ein kleiner biologischer Reaktor funktionieren. Im Körper eines Aals gibt es etwa 6.000 dieser Organe.
Je aktiver der Fisch ist, desto schneller und mehr Elektrizität sein Körper erzeugt. Ruht der Aal, ist das elektrische Feld um ihn herum sehr schwach. Wird er aktiv oder gar gestresst, umso stärker wird das elektrische Feld um ihn herum, was letztendlich zu einer Entladung führt.
Wofür setzt Zitteraal seine Elektrizität ein?
Die elektrischen Organe des Zitteraals dienen nicht nur als Mittel, um seine Beute zu betäuben, sondern auch zur Elektroortung. Dafür verfügt der Zitteraal über spezielle Elektrorezeptoren, die es ihm ermöglichen, Verzerrungen des elektrischen Feldes zu erkennen. Mit anderen Worten die Elektroortung hilft dem Aal, sich in schlammigem Wasser zurechtzufinden und versteckte Beute zu finden.
Sobald der Zitteraal einen elektrischen Stromschlag auslöst, beginnt der versteckte Beutefisch durch Krämpfe unkontrolliert zu zucken. Diese Vibrationen werden von den Raubfischen leicht erkannt und die Beute lokalisiert. Der Zitteraal ist also sowohl elektrorezeptiv als auch elektrogen. Es wird auch angenommen, dass die Männchen das elektrische Feld nutzen, um Weibchen zu finden.
Warum bekommt der Zitteraal selbst keinen Schlag?
Die Wissenschaftler sind sich der Antwort auf diese Frage nicht ganz sicher, es gibt allerdings ein Paar plausible Theorien. Erstens befinden sich die lebenswichtigen Organe des Zitteraals (z.B. das Gehirn und das Herz) in der Nähe des Kopfes, weit weg von den Organen, die Strom erzeugen, und sind darüber hinaus mit Fettgewebe umgeben, das als Isolator wirken kann. Es wurde auch beobachtet, dass Aale mit geschädigter Haut anfälliger für ihre eigenen Stromstöße sind.
Zweitens erzeugen Zitteraale während der Paarung einige der stärksten Stromstöße, die aber dem Partner nicht schaden. Wenn diese Stromschläge jedoch außerhalb der Paarung erzeugt werden, sind sie in der Lage, den anderen Aal zu töten. Dies lässt darauf schließen, dass diese Fische über ein Schutzsystem verfügen, das sich ein- und ausschalten lässt.
Wie ernährt sich der Zitteraal?
Während junge Zitteraale sich überwiegend von Insekten ernähren, fressen ausgewachsene Exemplare Fische, Amphibien, Vögel und sogar kleine Säugetiere, die sich ins Wasser verirrt haben. Bisher ging man auch davon aus, dass Zitteraale Einzelgänger sind, die tagsüber ruhen und nachts allein auf Beutefang gehen. Im Jahr 2012 beobachteten Forscher jedoch, wie eine Gruppe von Zitteraalen in einem Nebenfluss des Amazonas gemeinsam Fische jagten, wie im folgenden Video gut zu sehen ist.
Fortpflanzung des Zitteraals
Die Brutzeit der Zitteraale dauert von September bis Dezember. Diese Spezies hat eine sehr interessante Art der Fortpflanzung. In der Trockenzeit baut das Männchen ein Nest aus Schleim bestimmter Wasseralgen, in das das Weibchen seine Eier legt. Die Jungfische sind nach dem Schlüpfen etwa 10 cm groß. Ein Zitteraal-Weibchen kann bis zu 17.000 Eier produzieren. Geschlechtsreife werden Zitteraale mit 3-4 Jahren.